Talk about
15.10.2025 | Susanne Neumann
Eindeutigkeit durch den Gentest?
Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio wurden von den Athletinnen verpflichtende Gentests verlangt, die das Vorhandensein des Y-Chromosoms anhand des SRY-Gens nachweisen sollten. Ziel war es, die Integrität des Frauensports zu sichern und festzustellen, ob eine Athletin biologisch männlich ist.
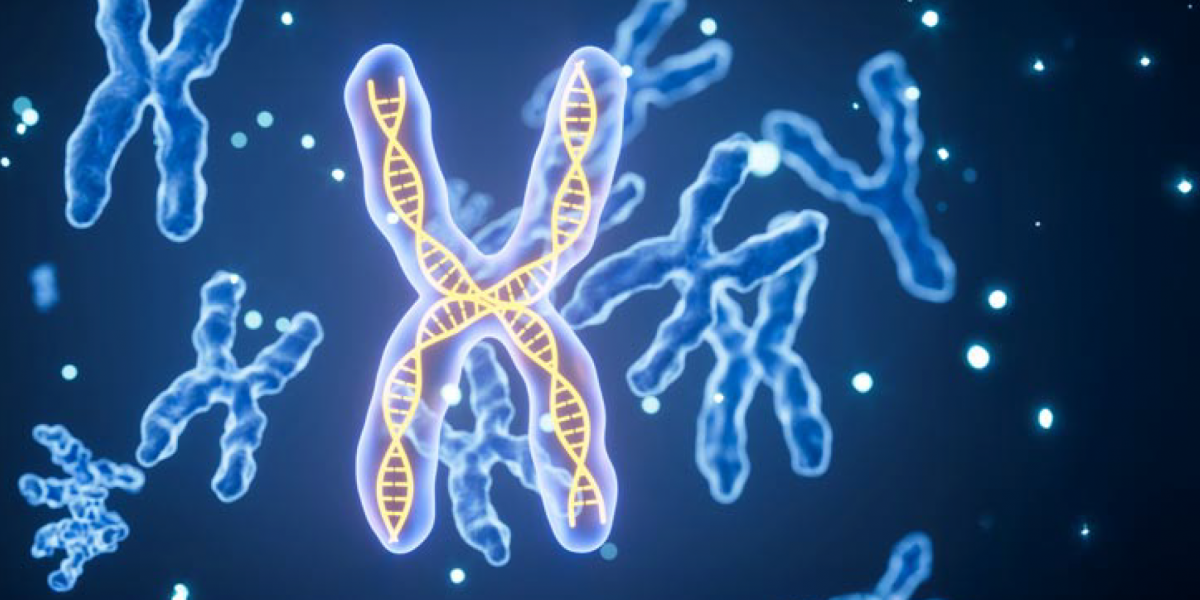
Die Einführung dieser Tests durch den Weltverband World Athletics stieß auf Kritik, unter anderem von der deutschen Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die Silbermedaillengewinnerin im Weitsprung ist. Sie bezeichnete die Maßnahme als „juristisch fragwürdig, ethisch heikel und wissenschaftlich verkürzt“. Der Weltverband argumentiert, dass der Test helfen soll, Athletinnen zu identifizieren, die aufgrund ihrer Genetik einen unfairen Vorteil in der Frauenkategorie haben könnten. Die Debatte wirft jedoch grundlegende Fragen zur Definition des biologischen Geschlechts auf, da dieses nicht immer binär ist und von komplexen genetischen Einflüssen geprägt wird.
Imane Khelif – Olympiasiegerin im Weltergewicht
Ein anschauliches Beispiel ist die algerische Olympiasiegerin Imane Khelif. Ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde von öffentlichen Diskussionen und Fehlinformationen begleitet, die sich teilweise auf ihre „männliche Ausstrahlung“ bezogen. Auch ihr Kampfstil wurde von einigen als „männlich“ wahrgenommen. Khelif hat sich durch ihre schnelle Siegesserie und ihren Kampfgeist hervorgetan und wurde Olympiasiegerin im Weltergewicht.
Was genau wird getestet?
Der seit September dieses Jahres im Leichtathletikverband angewandte Test erfolgt mittels Wangenabstrich oder Blutprobe. Er prüft, ob die Athletinnen das sogenannte SRY-Gen besitzen. SRY steht für „sex determining region of Y“ und befindet sich in der Regel auf dem Y-Chromosom – allerdings nicht immer. In den meisten Fällen führt das Vorhandensein des Y-Chromosoms und des SRY-Gens zu einem männlichen Körperschema.
Die Entwicklung des biologischen Geschlechts ist jedoch komplex und beginnt etwa in der sechsten Schwangerschaftswoche. Wer das SRY-Gen im Erbgut trägt, bildet – sofern das Gen nicht mutiert ist – das sogenannte TDF-Protein. Dieses steuert in der Embryonalentwicklung die Bildung männlicher Geschlechtsorgane. Ist das SRY-Gen aktiv und funktionieren alle biologischen Folgeschritte, entwickelt sich in der Regel ein Mensch mit männlichem Phänotyp, also mit Penis und Hoden sowie ab der Pubertät mit tieferer Stimme und Körperbehaarung. Fehlt das Signal des SRY-Gens, entsteht normalerweise ein weiblicher Phänotyp mit Eierstöcken, Vulva und Brustentwicklung.
Nicht immer ist alles eindeutig
Die Entwicklung der Keimdrüsen hängt vom TDF-Gen ab. TDF sorgt dafür, dass sich Hoden bilden. Ohne TDF entwickeln sich die Keimdrüsen zu Eierstöcken. Im Hoden entstehen zwei wichtige Zelltypen. Diese produzieren verschiedene Hormone. Einige Hormone verhindern die Entwicklung weiblicher Geschlechtsorgane. Andere produzieren Testosteron. Testosteron wird in Dihydrotestosteron (DHT) umgewandelt. DHT ist wichtig für die Entwicklung der äußeren männlichen Geschlechtsorgane.
Manchmal liegt das Problem nicht am Hormon selbst, sondern daran, dass der Körper es nicht erkennt. In solchen Fällen ist der Androgenrezeptor verändert. Normalerweise binden Testosteron und DHT an diesen Rezeptor. So starten sie die männliche Geschlechtsreifung. Wenn der Rezeptor nicht funktioniert, können die Hormone ihre Wirkung nicht entfalten. Dann fehlt dem Körper das Signal „männlich“. Der Körper entwickelt automatisch weibliche Merkmale, obwohl das SRY-Gen vorhanden ist.
Fehlen die Signale für männliche Merkmale, entsteht ein weiblicher Phänotyp. Es gibt auch Menschen mit XY-Chromosomen und Gonadendysgenesie. Diese können trotz SRY-Gen eine Gebärmutter entwickeln.
Hürdenläuferin Maria José Martínez Patiño
Ein Beispiel dafür ist die spanische Hürdenläuferin Maria José Martínez Patiño. Sie hat eine vollständige Androgenresistenz (CAIS), wie die Los Angeles Times berichtete. 1986 schloss das spanische Nationalteam Patiño aus, nachdem ein Geschlechtstest bei ihr das Y-Chromosom nachgewiesen hatte. Lange Zeit galt dieses Chromosom als sicheres Zeichen für ein biologisch männliches Geschlecht. Wie viele Menschen von CAIS betroffen sind, ist nicht genau bekannt. Denn die meisten wissen nicht, welche Chromosomen sie in ihren Zellen haben. Betroffene haben meist Hoden, die innen im Körper liegen. Sie besitzen keine Gebärmutter und keine Eierstöcke. Deshalb bekommen sie auch keine Regelblutung. Nach den neuen Regeln in der Leichtathletik darf eine Person mit nachgewiesener CAIS in der Frauenklasse starten.
Erste Tests gab es 1946
Die Sportverbände führten 1946 die ersten Geschlechtstests ein. Damals untersuchten sie nur die äußeren Geschlechtsorgane. Heute weiß man, dass das Vorhandensein oder Fehlen eines Penis nicht allein das Geschlecht bestimmt. Bei Menschen mit DSD (Störungen der Geschlechtsentwicklung) können die äußeren Geschlechtsorgane unterschiedlich ausgeprägt sein. Sie reichen von „normal“ weiblich bis „normal“ männlich.
Fazit:
Es bleibt also abzuwarten, wie sich sportliche Wettbewerbe in Zukunft aufstellen und damit auseinandersetzen, dass und wie Geschlechter-Klassifizierungen gerecht bewertet werden.
Autor
Susanne Neumann
Leitende Redakteurin #FITNESS

‹ Zurück




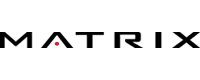








Coming soon!